Colocation: Wann lohnt sich Server Housing?
Immer mehr Unternehmen setzen auf Colocation bzw. Server Housing. Das bedeutet: Sie bringen ihren eigenen Server in einem externen Rechenzentrum unter.

Colocation bedeutet den Betrieb eigener IT-Hardware im Rechenzentrum eines Drittanbieters, um Kosten zu sparen und eine höhere Ausfallsicherheit zu erzielen.
Das Wort Colocation setzt sich aus den lateinischen Begriffen „co“ (zusammen, mit) und „lokus“ (Ort) zusammen. Ein Colocation-Rechenzentrum wird von mehreren Kunden genutzt, um die eigenen Server in einer geeigneten, sicheren Umgebung zu betreiben. Die Hardware gehört also dem Unternehmen, steht aber in einem externen Rechenzentrum. Man spricht daher auch von Server Housing.
Die IT ist in der digitalisierten und vernetzten Welt zum Herzstück von Unternehmen geworden. Vor allem Server sind zentraler Bestandteil einer jeden Unternehmens-IT, auf denen alle geschäftsrelevanten Daten lagern. Immer mehr Daten erfordern aber auch eine zunehmend leistungsfähige IT-Infrastruktur – die rund um die Uhr verfügbar sein muss.
Doch viele Unternehmen haben weder den Raum noch das nötige Fachpersonal, um die wachsende IT-Infrastruktur 24/7 zu betreuen. Zudem steigt mit der Menge an Daten und Komplexität der Infrastruktur auch der Aufwand für Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Aber nicht jedes Unternehmen möchte oder kann seine Daten in die Cloud migrieren. Colocation ist deshalb interessant für Unternehmen, die ihre IT sicher und performant betreiben möchten, ohne dazu ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen. Stattdessen können sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft fokussieren.

Colocation-Anbieter wie plusserver entlasten den Kunden von Infrastrukturaufgaben und sorgen für eine hohe Verfügbarkeit. Bild: plusserver
Colocation bietet allen voran natürlich den großen Vorteil, dass Unternehmen kein eigenes Rechenzentrum aufbauen und betreiben müssen. Denn damit sind sehr hohe Investitionskosten in Infrastruktur und Personal verbunden. Allein die Planung und Errichtung eines Rechenzentrums inklusive aller Sicherheits- und Leistungsmerkmale des Tier-3-Standards wird schon teuer. Dazu kommen dann noch die laufenden Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung.
In einem Colocation-Rechenzentrum werden diese Gesamtkosten auf alle Nutzer umgelegt. Der eigene Anteil fällt also entsprechend gering aus. Zudem verlagern sich Investitionskosten zu Betriebskosten, die steuerlich direkt abzugsfähig sind. Denn die Unternehmen „mieten“ die bestehende RZ-Infrastruktur eines Betreibers. Unter dem Strich sparen Unternehmen also in den meisten Fällen viel Geld. Dadurch können sie sich voll und ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft fokussieren und dort auch gezielt höhere Mittel investieren.

Zur Ausstattung eines Colocation-Rechenzentrums gehören Serverracks, redundante Stromversorgung und Klimatisierung, Internetanbindung bis hin zu „Remote Hands“ für Wartungsarbeiten.
Ja, das kann man so sagen. Denn der Betreiber des Rechenzentrums ermöglicht seinen Kunden das Aufstellen der eigenen Server in seinem Data Center. Das Modell der Colocation wird auch als Server Housing bezeichnet, weil der Kunde eben explizit die eigene Hardware nutzt. Der Anbieter stellt ihm dazu die benötigte Anzahl dedizierter, also dem Kunden allein zugewiesener und zugänglicher Racks zur Verfügung. Hinzu kommen Strom- und Internetzugang sowie die Klimatisierung. Der Kunde bestimmt jedoch allein über die Hard- und Softwarekonfiguration seiner Server.
Grundsätzlich eignet sich Colocation für Unternehmen jeder Größe und Branche, wenn die Nutzung moderner Cloud-Technologien keine Alternative ist. Oder wenn der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums aufgrund hoher Kosten und knapper personeller Ressourcen nicht infrage kommt.
Zudem ist Colocation immer dann empfehlenswert, wenn der oder die Server sehr individuellen Ansprüchen entsprechen. Wenn es also um hochsensible Daten geht oder sehr spezialisierte Programme betrieben werden. Auch die unternehmenseigenen Compliance-Richtlinien oder laufende Hardwareverträge können bei der Entscheidung eine Rolle spielen.
Ja, viele Colocation-Anbieter offerieren inzwischen auch dedizierte Zusatzservices. Im Rahmen dieser Colocation Services übernimmt der Betreiber des Rechenzentrums bestimmte Arbeiten an den Servern des Kunden. Dies geschieht jedoch ausschließlich nach einer entsprechenden Beauftragung durch den Kunden.
Als sogenannte „Remote Hands“ führen Techniker des Providers dann vor Ort die vorab klar definierten Handlungen aus. Meist handelt es sich dabei um Routineaufgaben. Dazu gehören beispielsweise der Tausch von Festplatten oder Netzteilen, die Überprüfung der Status-LED oder Anpassungen an der Netzwerkverkabelung. Umfassende und administrative Arbeiten am Server selbst übernehmen jedoch meist die eigenen IT-Mitarbeiter des Unternehmens. Denn sie sind bereits mit den individuellen Hard- und Softwarespezifikationen der unternehmenseigenen IT vertraut.
Für einige Unternehmen stellt sich die Frage Colocation vs. Server Hosting. Beim Server Hosting mietet der Kunde komplette Server bei einem Provider. Dies können dedizierte oder virtuelle Server (VPS) sein. Der Provider übernimmt folglich zusätzlich zur RZ-Infrastruktur auch alle mit der Server-Hardware verbundenen Aktualisierungs- und Wartungsarbeiten. Bei einer Colocation muss das IT-Team des Kunden diese Arbeiten selbst durchführen. Einige Colocation Provider bieten dies allerdings auch als Managed Service an.
| Colocation | Server Hosting | Cloud | |
|---|---|---|---|
| Kosten | Anschaffungskosten für Server | Monatliche Mietgebühr | Nach Verbrauch |
| Besitz | Server sind Eigentum | Server werden gemietet | IT-Ressourcen werden gemietet |
| Kontrolle | Mehr Kontrolle | Weniger Kontrolle | Weniger Kontrolle |
| Hardwareupgrades | Selbst | Provider | Provider |
| Software | Eigenverantwortung | Je nach Angebot | Eigenverantwortung bis Software as a Service |
| Expertise | Technische Expertise erforderlich | Je nach Angebot (unmanaged bis fully managed) | Je nach Angebot (Selfservice bis Managed Cloud) |
| Dedizierte Server | Ja | Ja | Nein |
| Externes Rechenzentrum | Ja | Ja | Ja |
| Ausfallsicherheit | RZ und Infrastruktur (Strom, Internet) | Bis zur Serverebene | Je nach Angebot, bei SaaS bis zur Softwareebene |
| Skalierbarkeit | Anschaffung weiterer Server, Anmietung weiterer Racks | Anmietung weiterer Server | Schnell und in kleinen Schritten |
| Geeignet für | Outsourcing größerer Serverfarmen | Auch einzelne Server möglich | Alle Anforderungen |
Zum einen sollten die Unternehmen auf die Verfügbarkeit und Performance des Rechenzentrums achten. Zum anderen sollte durch zusätzliche Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen sichergestellt sein, dass die Daten auch vor Fremdzugriff und Komplettverlust geschützt sind. Für die Auswahl eines Colocation-Rechenzentrums bietet der sogenannte „Tier-Standard“ eine gute und allgemeingültige Klassifizierung.
Empfehlenswert ist ein Tier-3-Rechenzentrum, das sichere Stromversorgung und zuverlässigen Internetzugang mit hoher Bandbreite bis zu 10 Gbit/s bietet. Das sind die entscheidenden Faktoren, um einen reibungslosen Betrieb und eine schnelle Anbindung zu gewährleisten. Dabei spielt auch die Entfernung zum eigenen Standort eine wichtige Rolle. Denn einerseits beschleunigt eine geringe Distanz zwischen Server- und Unternehmensstandort die Datenübertragung. Andererseits bietet die räumliche Nähe den Vorteil, dass Arbeiten am eigenen Server für die IT-Mitarbeiter mit geringerem Zeit- und Reiseaufwand verbunden sind.
Darüber hinaus dienen Zertifizierungen als gutes Qualitätsmerkmal und Orientierung. Dazu zählt beispielsweise ein nachweislich geprüftes und wirkungsvolles Informationssicherheits-Managementsystem – kurz ISMS. Kann der Colocation-Betreiber das entsprechende Zertifikat gemäß ISO 27001 vorweisen, wissen die Kunden: ihre Daten sind in sicheren Händen.
Rechenzentren werden nach dem sogenannten Tier-Standard klassifiziert. Er bietet Unterscheidungskriterien für die Rechenzentren bezüglich ihrer jeweiligen Verfügbarkeit und Redundanz.
Tier 1
Dieses Level bietet den Kunden keine Redundanz. Das bedeutet, Komponenten sind nicht doppelt ausgelegt und es gibt nur einen Versorgungsweg für Internetanbindung, Energie und Kälteverteilung. In einem T1-Rechenzentrum ist keine Wartung im laufenden Betrieb möglich und es ist nicht fehlertolerant. Die Verfügbarkeit liegt bei 99,67 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Ausfallzeit von 28,8 Stunden.
Tier 2
In einem T2-Rechenzentrum gibt es redundant ausgelegte Komponenten und die Verfügbarkeit liegt bei 99,75 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Ausfallzeit von rund 22 Stunden.
Tier 3
Tier 3 bietet neben redundanten Komponenten auch Server, die doppelt vorhanden sind. Man spricht hier auch von einem fehlertoleranten System, das Wartungsarbeiten auch während des laufenden Betriebs ermöglicht. Zudem gibt es mehrfache aktive und passive Versorgungswege für Internet, Strom und Kühlung sowie mehrere Brandabschnitte. Die Verfügbarkeit liegt bei 99,98 Prozent, was einer jährlichen Ausfallzeit von 1,6 Stunden entspricht.
Tier 4
Das Level Tier 4 ist sozusagen die Königsklasse. Solche Rechenzentren sind komplett redundant ausgelegt. SPOFs (Single Point of Failure), also Bestandteile eines technischen Systems, dessen Ausfall den Ausfall des gesamten Systems nach sich zieht, sind nahezu ausgeschlossen. In einem T4-Rechenzentrum kann sich der Kunde auf eine maximale Verfügbarkeit verlassen. Sie liegt bei 99,991 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Ausfallzeit von nur 0,8 Stunden. Bei einem solchen Rechenzentrum spricht man auch von K-Fall-fähig. Das bedeutet es ist auch in einem Katastrophenfall, beispielsweise bei einem Brand, weiterhin einsatzfähig.
Ja, bei Bedarf und je nach Colocation-Betreiber können Unternehmen auch eine Georedundanz-Strategie umsetzen. plusserver betreibt beispielsweise Rechenzentren in allen wichtigen deutschen Metropolen und setzt unmittelbar auf die europäische Fiber-Backbone-Route auf. Damit bietet der Provider mehrere vollständig funktionsfähige Rechenzentren an entfernten Standorten mit einer Distanz ab 200 Kilometer. Das entspricht der Empfehlung des BSI und ermöglicht den ausfallsicheren Betrieb der entsprechenden Server und IT.
Jetzt Artikel teilen:
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN:
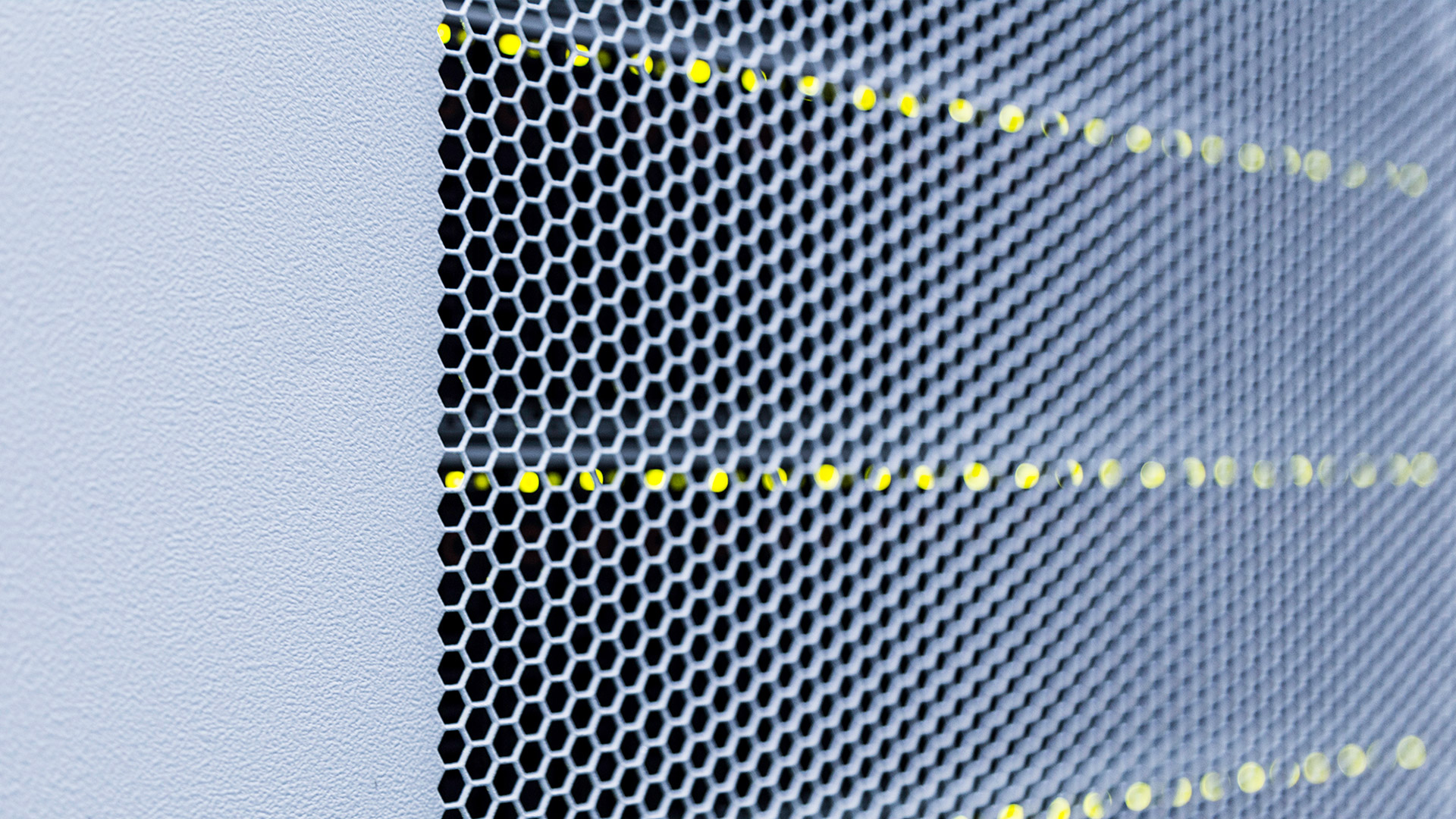
Immer mehr Unternehmen setzen auf Colocation bzw. Server Housing. Das bedeutet: Sie bringen ihren eigenen Server in einem externen Rechenzentrum unter.

Ein Load Balancer dient als Lastverteiler in einer Server- oder Cloud-Infrastruktur.

Die Corona-Pandemie hat die S/4HANA-Transformation zunächst ins Stocken gebracht und den Fokus neu ausgerichtet.
Bitte wählen Sie einen der unten stehenden Links, um zum gewünschten Portal zu gelangen.
Bei Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner.
Für die Darstellung dieser Inhalte von YouTube benötigen wir Ihre Einwilligung. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, werden Ihre Daten verarbeitet und es werden Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert sowie von diesem gelesen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einwilligung für 30 Tage ( in einem Cookie) speichern