Fünf Tipps für eine erfolgreiche Multi-Cloud Migration
Immer mehr Unternehmen verteilen ihre Workloads auf mehrere Cloud-Anbieter. Mit diesen fünf Tipps steht der Multi-Cloud-Migration nichts im Weg.

Open Source Software bietet Unternehmen mehr Flexibilität, Selbstbestimmtheit und digitale Souveränität.
Bei Open Source handelt es sich um ein Software-Entwicklungsmodell. Dabei steht der Quellcode öffentlich zur Verfügung und jeder kann diesen einsehen, weiterentwickeln und nutzen. Da der Code im Grunde niemandem gehört, ist es zudem häufig möglich, Open Source Software (OSS) kostenfrei zu verwenden. Besonders die Kostenaspekte und die Unabhängigkeit von bestimmten Anbietern machen die Software im Vergleich zu proprietären Lösungen interessant für Unternehmen.
Open Source Software wird in der Regel dezentral und kollaborativ entwickelt. Das bedeutet: Es gibt eine Vielzahl von Projekten, an denen unterschiedliche Entwickler gemeinsam in der Open Source Community arbeiten. Unternehmen haben die Wahl, Open Source Software entweder nur zu nutzen oder sich aktiv an der Weiterentwicklung zu beteiligen. Wird eine bestehende Open-Source-Anwendung durch ein Unternehmen weiterentwickelt, werden die Verbesserungen in der Regel auch der Community zur Verfügung gestellt. So entsteht ein aktiver Prozess von Geben und Nehmen, in dem alle profitieren. Zusätzlich können Unternehmen die Open Source Community durch die kostenpflichtige Nutzung von Service- und Support-Leistungen unterstützen.
Der Einsatz von Open Source bietet Unternehmen eine Reihe an konkreten Vorteilen:
Open Source Software ist quellcodeoffen. Das bedeutet, dass Unternehmen sich damit nicht an herstellergebundene Technologien binden, sondern die volle Wahlfreiheit behalten. Sie können also anbieterunabhängig, technologisch selbstbestimmt und flexibel handeln. Und bei Interesse können sie Teile der Software selbst weiterentwickeln und der Open Source Community damit etwas zurückgeben.
Aus dem ersten Vorteil ergibt sich auch gleich der nächste. Denn durch offenen Code sind Unternehmen nicht an einen Hersteller gebunden und behalten stets die Kontrolle über ihre Daten. Daher spricht man auch von Datensouveränität.
Ein nicht unwesentlicher Aspekt bei Open Source sind gezielte Kosteneinsparungen, da bei der Nutzung keine Lizenzgebühren anfallen im Gegensatz zum Großteil der proprietären Software.
Open Source Software bietet den Anwendern im Vergleich zu proprietärer Software wesentlich mehr Freiheiten. Denn bei letzterer dürfen nur die rechtmäßigen Besitzer des Quellcodes auf diesen zugreifen oder ihn verändern. Der Anwender bezahlt dann dafür, eine funktionsfähige, sichere und aktuelle Software zu nutzen. Doch auch bei der Nutzung von Open Source Software gilt es einige Aspekte zu beachten. Dazu zählen die folgenden:
Auch bei Open Source Software gibt es unterschiedliche Lizenzmodelle. Dabei geht es jedoch mehr um Nutzerpflichten, die mit der Dokumentation und Offenlegung der Verwendung von Open-Source-Projekten zusammenhängen. Für Unternehmen ist es deshalb wichtig zu wissen, welche OS-Komponenten genau eingesetzt werden und welche Lizenzbedingungen hierfür gelten.
Denn auf Anfrage der Code-Urheber oder deren Rechtsvertreter müssen Unternehmen grundsätzlich nachweisen können, welche Komponenten und welchen Quellcode sie nutzen. Um das zu erleichtern, gibt es beispielsweise die Entwickler-Plattform GitHub. Sie hilft bei der Versionsverwaltung von OSS-Entwicklungsprojekten und erleichtert so den gesetzeskonformen Umgang mit Open Source Software wesentlich.
Grundsätzlich ist es auch bei Open Source Software ratsam, den Einsatz strategisch anzugehen. Der strategische Ansatz kann dabei sein, OSS nur zu nutzen oder sich auch aktiv an Open-Source-Projekten zu beteiligen. Hier haben die Unternehmen jedoch immer noch Nachholbedarf, wie der Bitkom "Open-Source-Monitor 2021" zeigt. Danach haben 72 Prozent der befragten Unternehmen ab 20 Beschäftigten keine OSS-Strategie.
Auch im Bereich OSS-Compliance haben die Unternehmen noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Zwar gibt es bereits bei 48 Prozent der befragten Unternehmen einen niedergeschriebenen Compliance-Prozess zum Umgang mit Open Source Software. Doch gibt es lediglich in 22 Prozent der Unternehmen aktuell eine konkrete Policy.
Die Nutzung von Open Source Software hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das bestätigt auch der „Open-Source-Monitor 2021“ des Branchenverbands Bitkom. Danach setzen heute sieben von zehn Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten (71 Prozent) bewusst OSS in ihrem Unternehmen ein. Nur ein Viertel der befragten Unternehmen (26 Prozent) setzt keinerlei OSS-Lösung ein.
Der Bitkom Open-Source-Monitor belegt, dass 41 Prozent der Befragten diese Offenheit als klaren Vorteil sehen. Dazu wurden in der Studie mehrere Aspekte abgefragt. Hierzu zählten: Zugriff auf den Quellcode, einfacher Anbieterwechsel, einfache Anpassung an eigene Bedürfnisse, große Auswahl an OSS-Komponenten, bessere Kompatibilität zwischen Tools und Komponenten, offene Standards und Interoperabilität sowie Vielzahl an OSS-Anbietern mit kommerziellem Support.
.png?width=1201&name=MicrosoftTeams-image%20(7).png)
Unternehmen und Organisationen müssen sich heute mehr denn je modernisieren. Viele Unternehmen haben dabei die hohe Bedeutung und die Vorteile der Cloud für die digitale Transformation erkannt und verinnerlicht. Allerdings nehmen auch die Bedenken in Bezug auf die Datensouveränität gerade bei den Angeboten der großen US-amerikanischen Anbieter zu. Denn in deren proprietären Systemen besteht die Gefahr, in eine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter, den sogenannten Vendor Lock-in, zu geraten.
Daher setzen Unternehmen zunehmend auf Open Source Cloud-Lösungen. Hier ist unter anderem das europäische Cloud-Projekt Gaia-X und dessen technologischer Unterbau Sovereign Cloud Stack SCS hervorzuheben, der komplett auf Open-Source-Technologien aufbaut. Auf dem deutschen Markt sind bereits erste Cloud-Angebote auf Basis des SCS verfügbar.
Zu den bekanntesten Open-Source-Anwendungen zählen folgende:
• Linux (Betriebssystem)
• Ubuntu (Betriebssystem)
• Mozilla Firefox (Browser)
• WordPress (Content-Management-System)
• OpenOffice (Office-Anwendungen)
• Docker (Container-Virtualisierungslösung)
• Kubernetes (Container-Orchestrierungsplattform)
• Hadoop (Basis für Big-Data-Anwendungen)
• VLC (Media Player)
Beim OpenChain Standard ISO 5230 handelt es sich um einen neuen internationalen Standard, der Ende 2020 veröffentlicht wurde. Er regelt die wichtigsten Anforderungen an ein hochwertiges Open-Source-Lizenz-Compliance-Programm. Denn sehr viele Unternehmen verlassen sich heute auf lizenzierte Open-Source-Komponenten. Deshalb hat der neue Standard zum Ziel, mehr Klarheit im Bereich Lizenz-Compliance zu ermöglichen.
Zudem sollen dadurch Softwarelieferketten sowie die Beschaffung erleichtert werden. Organisationen, die die Anforderungen des Standards erfüllen, können sich entsprechend zertifizieren lassen. Das erfolgt nach erfolgreichem Abschluss eines Audits nach ISO/IEC 17021 durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle. Außerdem können sich Unternehmen nach OpenChain 2.1 selbst zertifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Gerade im Öffentlichen Sektor ist es wichtig Datensouveränität zu schaffen und anbieterunabhängig agieren zu können. Deshalb kann Open Source gerade im Öffentlichen Sektor dazu beitragen, die Digitalisierung aktiv voranzutreiben. Laut Bitkom-Monitor nutzen aktuell immerhin schon 64 Prozent der Befragten in der Öffentlichen Verwaltung Open Source Software. Damit liegt der Öffentliche Sektor fast gleichauf mit der Nutzung in der Wirtschaft (71 Prozent).
Mehr über die Rolle von Open Source in der öffentlichen Verwaltung lesen Sie im Interview mit plusserver-CTO Stephan Ilaender.
Jetzt Artikel teilen:
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN:
.png)
Immer mehr Unternehmen verteilen ihre Workloads auf mehrere Cloud-Anbieter. Mit diesen fünf Tipps steht der Multi-Cloud-Migration nichts im Weg.

Open Source ist der Schlüssel zur Digitalisierung in der Verwaltung, sagt Stephan Ilaender, CTO von plusserver.
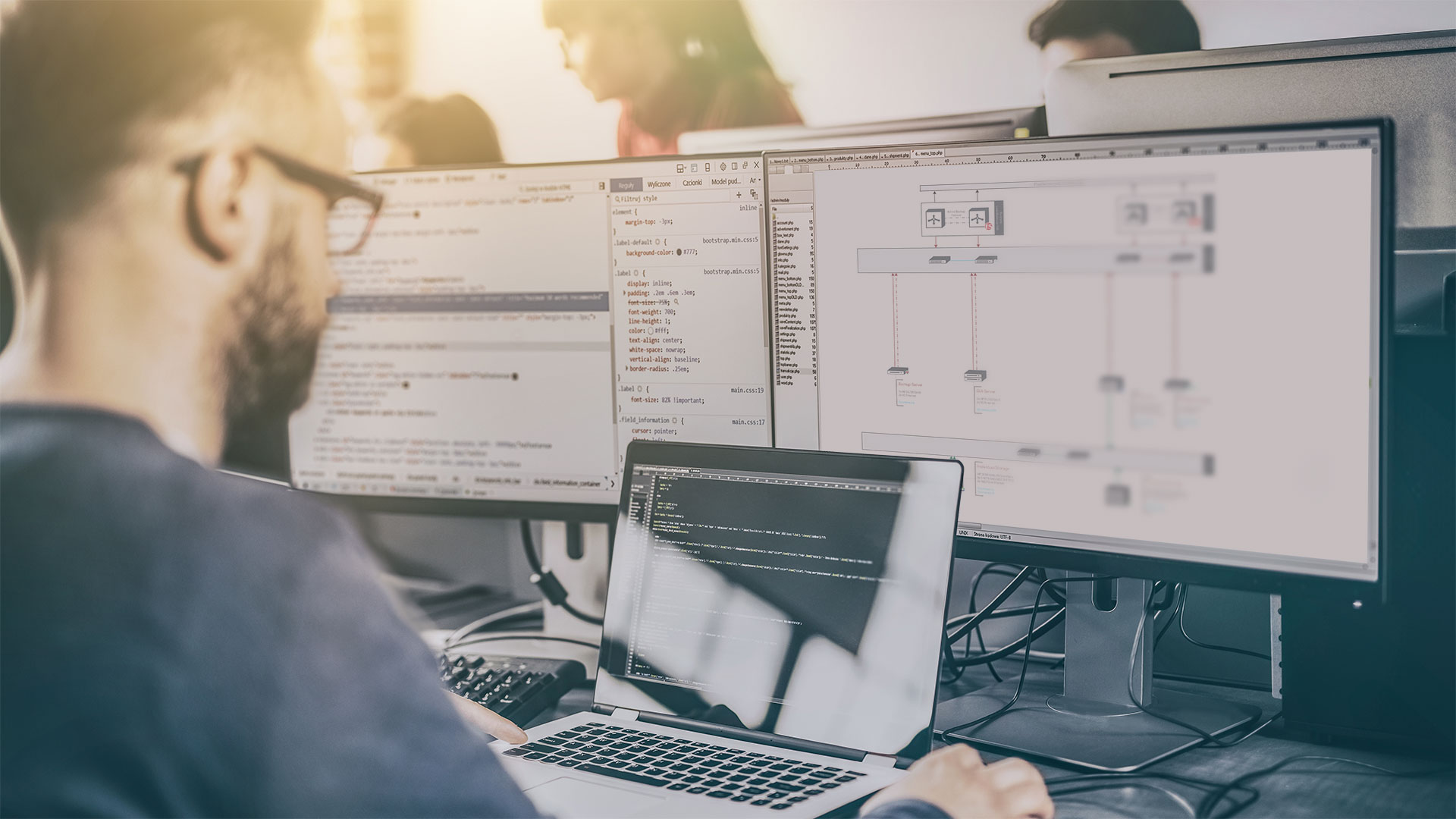
Wie ist der Status der Cloud-Migration in Deutschland? Welche Erwartungen, Erfahrungen und Herausforderungen haben deutsche Unternehmen in puncto Cloud?
Bitte wählen Sie einen der unten stehenden Links, um zum gewünschten Portal zu gelangen.
Bei Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner.
Für die Darstellung dieser Inhalte von YouTube benötigen wir Ihre Einwilligung. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, werden Ihre Daten verarbeitet und es werden Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert sowie von diesem gelesen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einwilligung für 30 Tage ( in einem Cookie) speichern